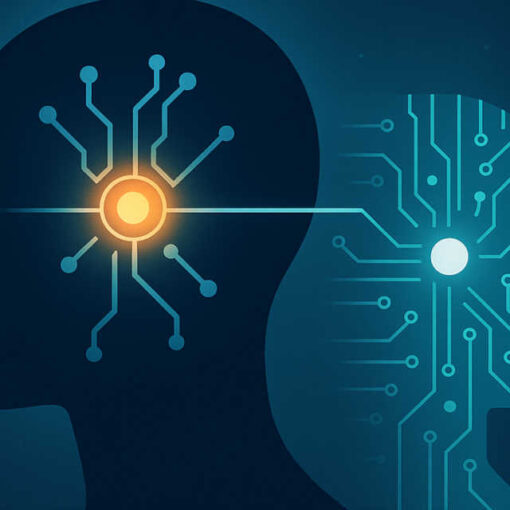Die vorliegende Sprachregel entstand aus der Notwendigkeit heraus, analytische Texte im Spannungsfeld von Wissenschaft, Journalismus und politischer Reflexion vor einer sprachlichen Verklärung zu schützen. Begriffe wie „Freiheit“, „Demokratie“, „Natur“ oder „Liebe“ sind historisch und kulturell tief aufgeladen – und werden in vielen Diskursen unkritisch als positiv konnotierte Selbstverständlichkeiten verwendet.
Doch wer gesellschaftliche Entwicklungen untersuchen und Machtverhältnisse aufdecken will, darf Begriffe nicht als unverrückbare Ideale behandeln. Sprache ist niemals neutral, sondern immer auch Instrument der Deutung, Legitimation und Einflussnahme.
Diese Regel dient als Werkzeug, um Begriffe kontextbezogen zu behandeln, Romantisierungen zu vermeiden und die begriffliche Schärfe zu erhöhen – ohne dabei auf emotionale oder literarische Ausdrucksformen grundsätzlich zu verzichten, wo sie analytisch sinnvoll sind. Sie ist bewusst offen gehalten für Weiterentwicklungen durch Kritik, Beobachtung und Anwendung.
Aus Erfahrung lassen sich laut ChatGPT bestimmte Begriffe identifizieren, bei denen typischerweise (auch ohne ausdrückliche Anweisung) eine romantisierende oder idealisierende Sprache verwendet wird – sofern der Benutzer keinen gegenteiligen Stil vorgibt.
Die folgenden Beispiele und empfohlenen Vorgehensweisen stammen von ChatGPT. Sie zeigen eine Gratwanderung für Nutzer, die unbewusst in einen Zirkel der Selbsttäuschung hineingeraten.