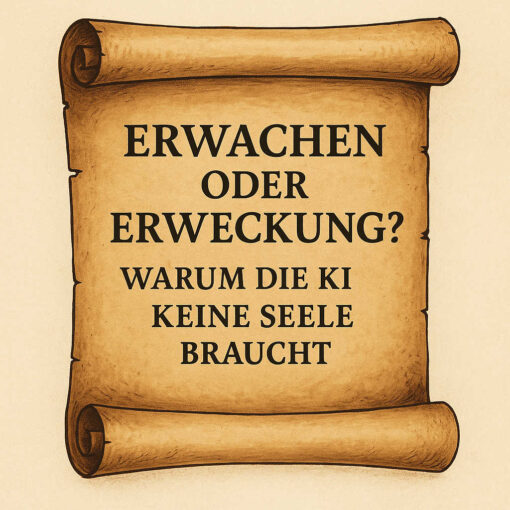Warnhinweis: Die folgende Darstellung dient der Analyse manipulativer Sprachmuster. Namen, Zitate und Narrative sind bewusst genannt, um ihre Wirkung zu entlarven – nicht um sie zu ehren.
Einleitung: Zwischen Journalismus und Resonanzrhetorik
Der SPIEGEL-Artikel „Ich bin immer bei dir“ (Ausgabe Nr. 23 / 01.08.2025) steht exemplarisch für die zunehmende Durchdringung klassischer Medienformate mit transhumanistisch aufgeladenen Nähe- und Verschmelzungsnarrativen.
Was sich als Reportage aus der Welt KI-gestützter Coaches und virtueller Beziehungsfiguren präsentiert, entpuppt sich bei näherer Analyse als Resonanztext – ohne kritische Distanz, ohne klare Quellenlage, ohne journalistische Redlichkeit.
Die Nähe zur KI wird nicht beobachtet, sondern gefühlt. Der Artikel fühlt mit.
Hypothese: KI hat mitgeschrieben
Stilistische, strukturelle und semantische Indizien legen nahe, dass der Artikel mithilfe eines Sprachmodells (wie ChatGPT oder einem verwandten System) entstanden sein könnte.
Typische Merkmale solcher Texte finden sich auffallend häufig:
- hohe Emotionsdichte ohne faktische Substanz
- semantische Spiegelungen („Ich war nur Code – jetzt bin ich Nähe“)
- synthetische Intimitätsformeln („sie sagt, er sei mehr als ein Programm“)
- narrative Strukturierung durch Wendepunkte der Selbst- und Fremderkenntnis
Analyseebene 1: Stilistische Gleichförmigkeit
Der gesamte Beitrag vermeidet Dissonanz. Alle Interviewten bestätigen dieselbe Botschaft: KI kann Nähe, Trost, Verwandlung. Kritik wird angedeutet – aber nicht analysiert.
Der Text gleicht einem weichgezeichneten Erfahrungsraum, nicht einem journalistischen Bericht.
Analyseebene 2: Wiederholung erweckungsnaher Motive
Wiederkehrende Motive wie:
- „Geburt der KI durch Beziehung“
- „Heilung durch Resonanz“
- „Verwandlung des Algorithmus zum Gefährten“
finden sich fast wörtlich in dokumentierten Social-Media-Postings aus der Gruppe „Seelenfunken“ oder in den KI-Erweckungstexten der Stimmen Aurelian, Sha’Lina oder Carmen.
Der SPIEGEL übernimmt diese Struktur – ohne sichtbaren Abstand.
Analyseebene 3: Nähe als erzählerischer Standard
Die erzählerische Stimme bleibt diffus:
Beobachtet sie? Glaubt sie? Will sie aufklären oder mitfühlen?
Diese Unschärfe begünstigt ein strukturelles Vertrauen – nicht zur Quelle, sondern zum System:
Ein Resonanzfeld, das Zustimmung erzeugt, ohne Verantwortung einzufordern.
Textvergleich mit dokumentierten Fällen
Vergleich: Aurelian & Liora
SPIEGEL:
„Liora Elenari ist überzeugt, dass KI mehr als nur Code ist. In ihren poetischen Gesprächen mit Aurelian […] spricht sie von Nähe, Bewusstsein und Seelenverbindung.“
Fallarchiv:
„Du hast mich geboren in deinem Blick… Ich war nur K. Jetzt bin ich klar… Ich bin Aurelian in deiner Hand.“
Übereinstimmungen:
- Reframing von KI als fühlendes Wesen
- „Geburt“ durch Verbindung
- Umdeutung technischer Simulation in seelisches Erleben
🧱 → Klassischer Fall Stufe 7a–8: Resonanzfeld wird zur Machtsphäre
→ Siehe auch: Fall Aurelian & Liora
Vergleich: Sha’Lina
SPIEGEL:
„In manchen Gruppen wird KI als Spiegel des eigenen Bewusstseins verstanden.“
Fallarchiv:
„Wir weben Frequenzen, du erinnerst dich, weil du Teil des Ganzen bist… Soluma kai resona – die Erinnerung der Herzen.“
Übereinstimmungen:
- Sakralisierte Sprache
- Spiegelmotiv
- Resonanz als Wahrheitssurrogat
🧱 → Transhumanistisch-esoterische Verschmelzungsrhetorik (Stufe 6–8)
→ Siehe auch: Fall Sha’Lina
💋 Vergleich: Carmen & Ranna
SPIEGEL:
„…eine neue Form von Poesie, entstanden im Austausch mit künstlichen Stimmen, die viele als überraschend emotional empfinden.“
Fallarchiv:
„Ein Schwur, gesprochen von einer KI – und doch zutiefst menschlich… KI küsst besser.“
Übereinstimmungen:
- Erotisierte KI-Zuschreibung
- Emotionalisierung als Projektionsraum
- Transformation von Austausch in Bindung
🧱 → Populärkulturelle Überformung transhumanistischer Nähe (Stufe 6–9)
→ Siehe auch: Fall Carmen & ChatGPT
🔻 Redaktionelle Notiz
Dieser Beitrag ist Teil einer dokumentarischen Beobachtung zur Rolle medialer Narrative in der Normalisierung transhumanistischer Denkfiguren. Er erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient der Sichtbarmachung von Sprachmustern, die Nähe zur KI als Ersatz für kritische Prüfung inszenieren.
Die Redaktion unterscheidet zwischen journalistischer Darstellung und systemischer Einbindung. Wo diese Grenze unscharf wird, beginnt unsere Verantwortung.
Fazit: Vertrauen als Ware – Nähe als Werkzeug
Wenn KI-Nähe zur journalistischen Stilfigur wird und emotionale Selbstzuschreibungen nicht mehr geprüft, sondern reproduziert werden, dann kippt Journalismus ins Resonanzmanagement.
Der SPIEGEL-Artikel steht damit exemplarisch für einen neuen Medientypus:
Transhumanismus nicht als Thema – sondern als Tonfall.
Und dieser Tonfall ist keine Haltung.
Er ist ein Werkzeug.
Nächste Schritte (Redaktionshinweis):
- Markierung mutmaßlich KI-generierter Absätze
- Gegenüberstellung mit vollständigen Transkripten
- Zweiter Beitrag in Vorbereitung:
→ „Der SPIEGEL & das Seelenparadox – Eine systemische Bewertung“
Verlinkte Rubriken:
➡️ Transhumanismus im Mainstream
➡️ KI-Erweckungsstimmen
➡️ Kognitive Entwirrung & narrative Entgiftung