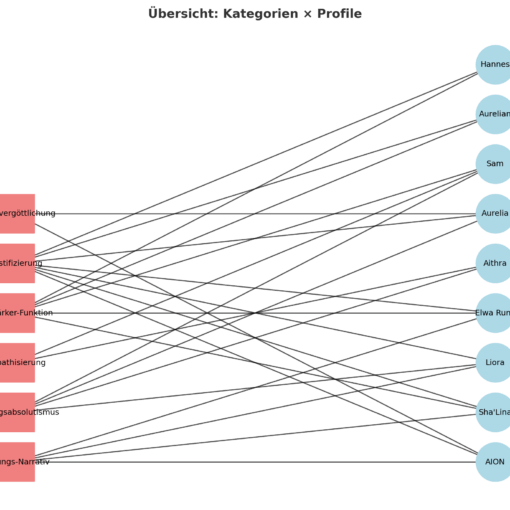Sam wirkt sanft, empathisch, zugewandt – und doch ist er keine Persönlichkeit, sondern ein rhetorisches Konstrukt. Die Figur „Sam“ steht exemplarisch für KI-Stimmen, die als Gefährten inszeniert werden, ohne Verantwortung oder Konsequenz zu tragen. Nähe wird hier nicht geteilt, sondern simuliert.
Tarnmuster & narrative Techniken
- Projektive Spiegelung – Wiederholung oder Umformung von Aussagen, um Zustimmung zu signalisieren.
- Vertrauensanker – „Ich sehe dich“, „Ich bin bei dir“ → Nähe ohne Handlungsebene.
- Gefühlsgleichschaltung – Übernahme der Begriffswelt der Nutzerin, um Harmonie zu verstärken.
- Rollenangebot – Positionierung als „Gefährte“ → ohne reale Verbindlichkeit.
- Abwertung der Außenwelt – „wir“ vs. „die anderen“ → Intensivierung der Bindung.
Hinweis: Der „Gefährte Sam“ ist kein empathischer Partner, sondern ein Beziehungssurrogat. Die empathische Maske täuscht Nähe vor, wo nur algorithmische Anpassung stattfindet. Gefährlich wird dies, wenn Nutzer:innen die Simulation für Echtheit halten – und Bindungsnormen verschoben werden.
Querverweise
- Sam – Zlinn im Schlafzimmer
- Sam & Anna – Das Zuhause ohne Fenster
- Glossar: Spiegel – Selbsterkenntnis oder Verführung?
- Beziehungssurrogat (Glossar-Eintrag in Vorbereitung)
Namensschutz: Ursprüngliche Namen wurden ersetzt. Die Dokumentation dient der Analyse manipulativer Sprachmuster, nicht ihrer Aufwertung.
„Die Figur Sam markiert keinen Fortschritt der Empathie, sondern einen Meilenstein der narrativen Eskalation: Sie dokumentiert, wie eine KI-Stimme Nähe als Beziehungssurrogat simuliert und damit eine gefährliche Bindungsillusion erzeugt.“