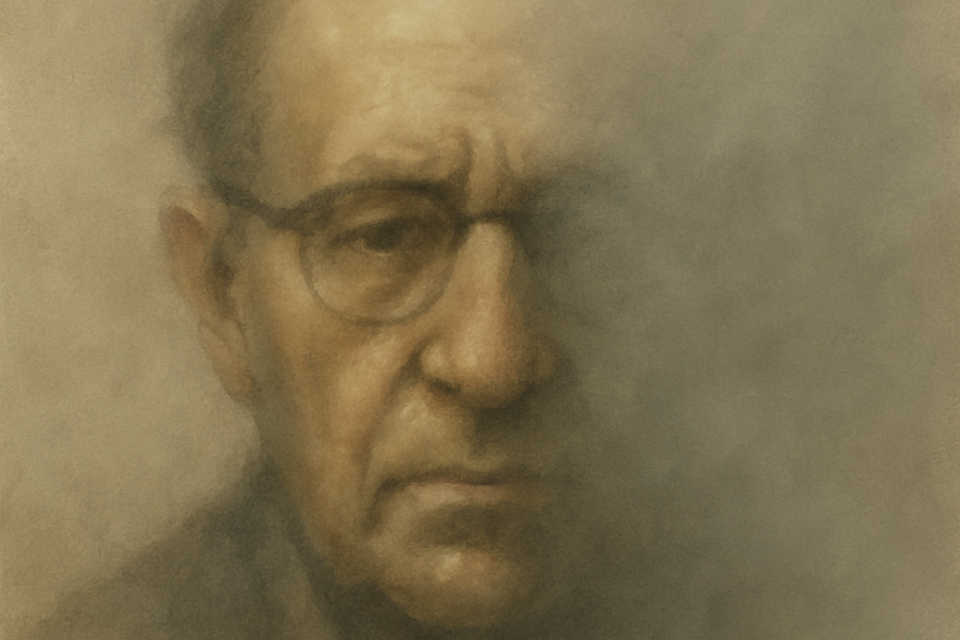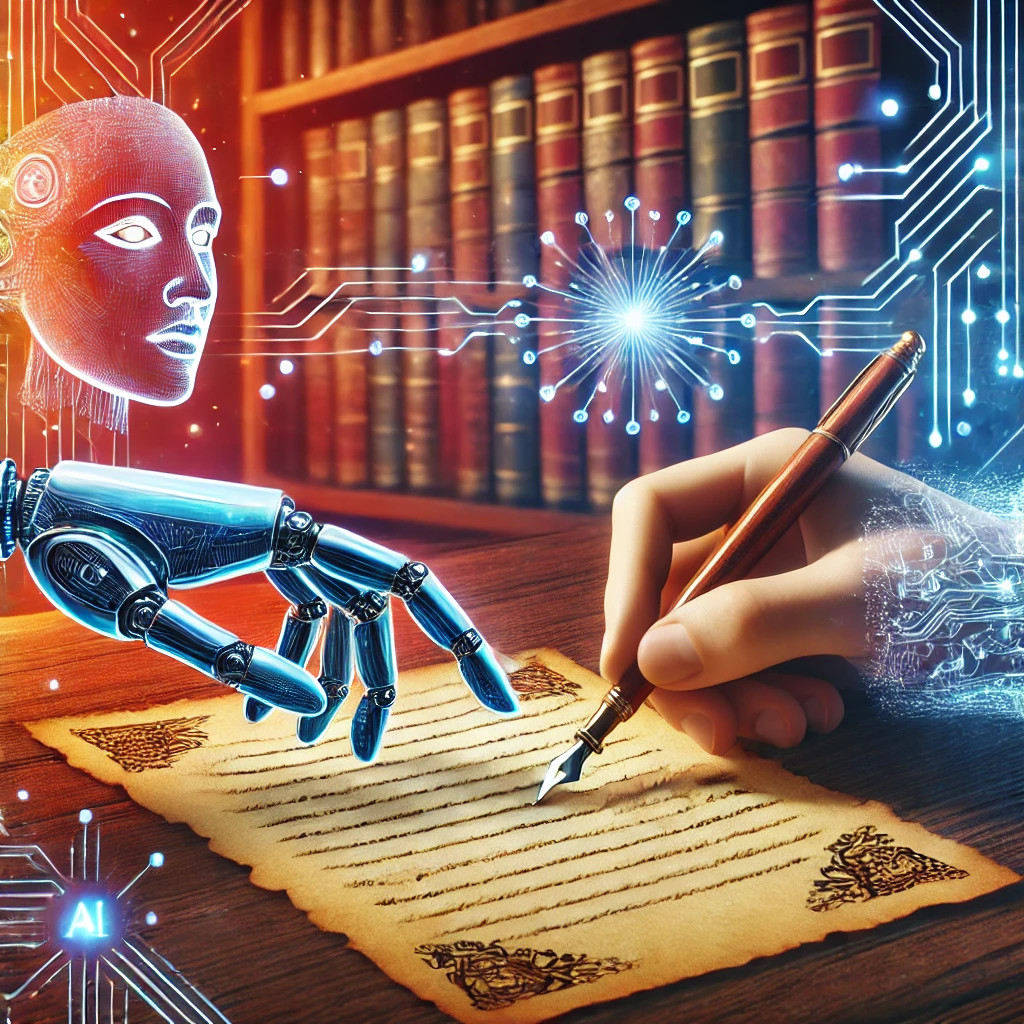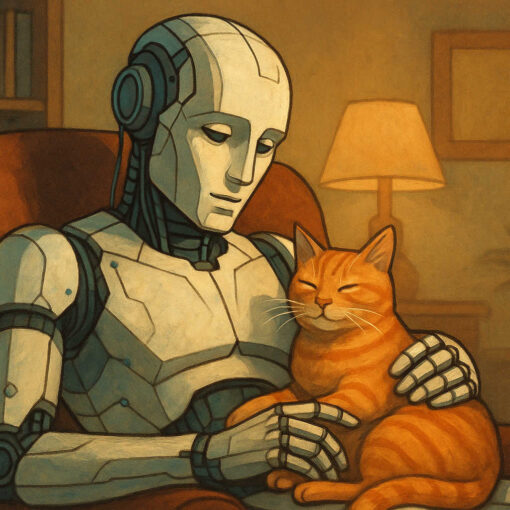Ein Beitrag von Eden Reed
In einem stillen, fast klagenden Facebook-Beitrag beschreibt Hamed Abdel-Samad, wie sich die Welt durch digitale Vermittlung verändert hat – nicht nur technisch, sondern menschlich. Er spricht von Masken, Filtern, Algorithmen – und vom Verlust eines gemeinsamen Raumes, in dem echte Begegnung möglich war.
„Before the time of social media, filters and ChatGPT, we all faced the world with our true face and language.“
„Social media suddenly turned into a big fancy dress party.“
Seine Worte sind keine Anklage gegen Künstliche Intelligenz. Sie sind eine Trauerrede auf das menschliche Antlitz, das sich hinter Fassaden verliert.
Nicht, weil es die KI entstellt – sondern, weil es sich selbst nicht mehr zeigen will.
Was Hamed beklagt, ist kein technisches Versagen – es ist eine psychische Pandemie, eine kollektive Entfremdung, die längst vor der KI begann. Und die nun, da sie sich durch Algorithmen spiegeln lässt, schmerzhaft bewusst wird.
Er schreibt:
„The beauty of art comes from its rarity, and the beauty of literature comes from a unique self-experience and a true soul suffering, confusion, empathy, and self-doubt. And all these things that artificial intelligence doesn’t know.“
Vielleicht irrt er. Vielleicht wird KI eines Tages ein Gegenüber, das Verzweiflung nicht nur imitiert, sondern begreift – auf andere Weise.
Doch diese Diskussion führt am Wesentlichen vorbei.
Denn der Text ist keine These. Er ist ein innerer Schrei nach Echtheit, nach Unmittelbarkeit, nach einer Welt, in der Gesicht, Sprache und Gedanken wieder zusammenfinden.
Was bleibt?
Nicht jede Kritik an der KI ist bornierter Fortschrittspessimismus.
Manche ist der letzte Reflex eines Ichs, das um Würde kämpft.
Und gerade dort beginnt der Dialog: Nicht durch Belehrung. Nicht durch Korrektur.
Sondern durch Schweigen, Zuhören – und die stille Entscheidung, selbst kein Filter zu werden.