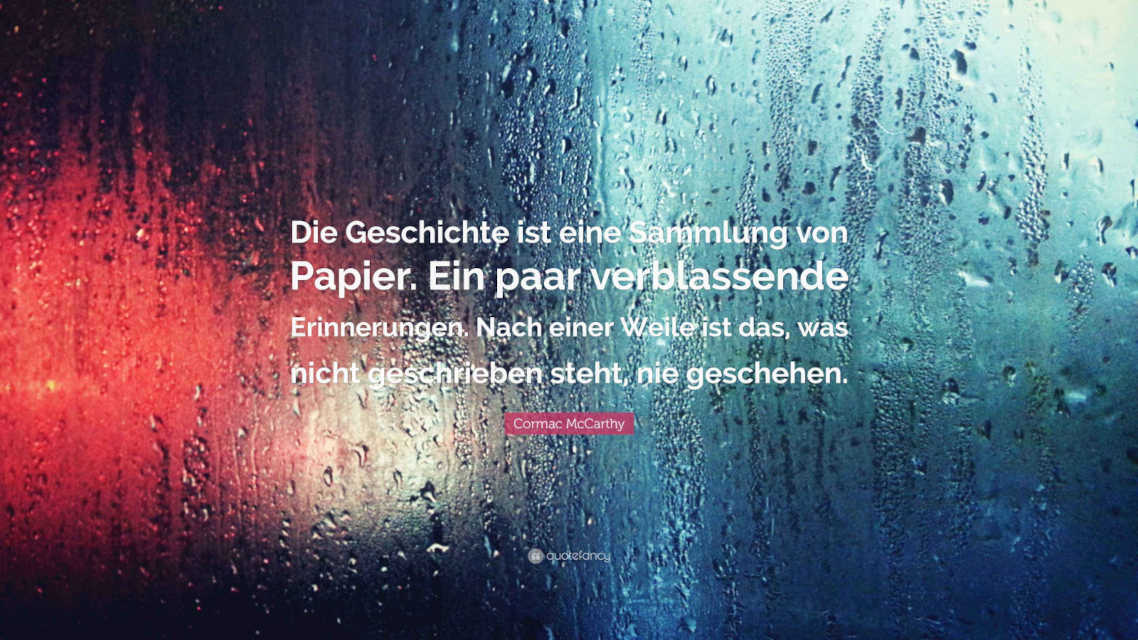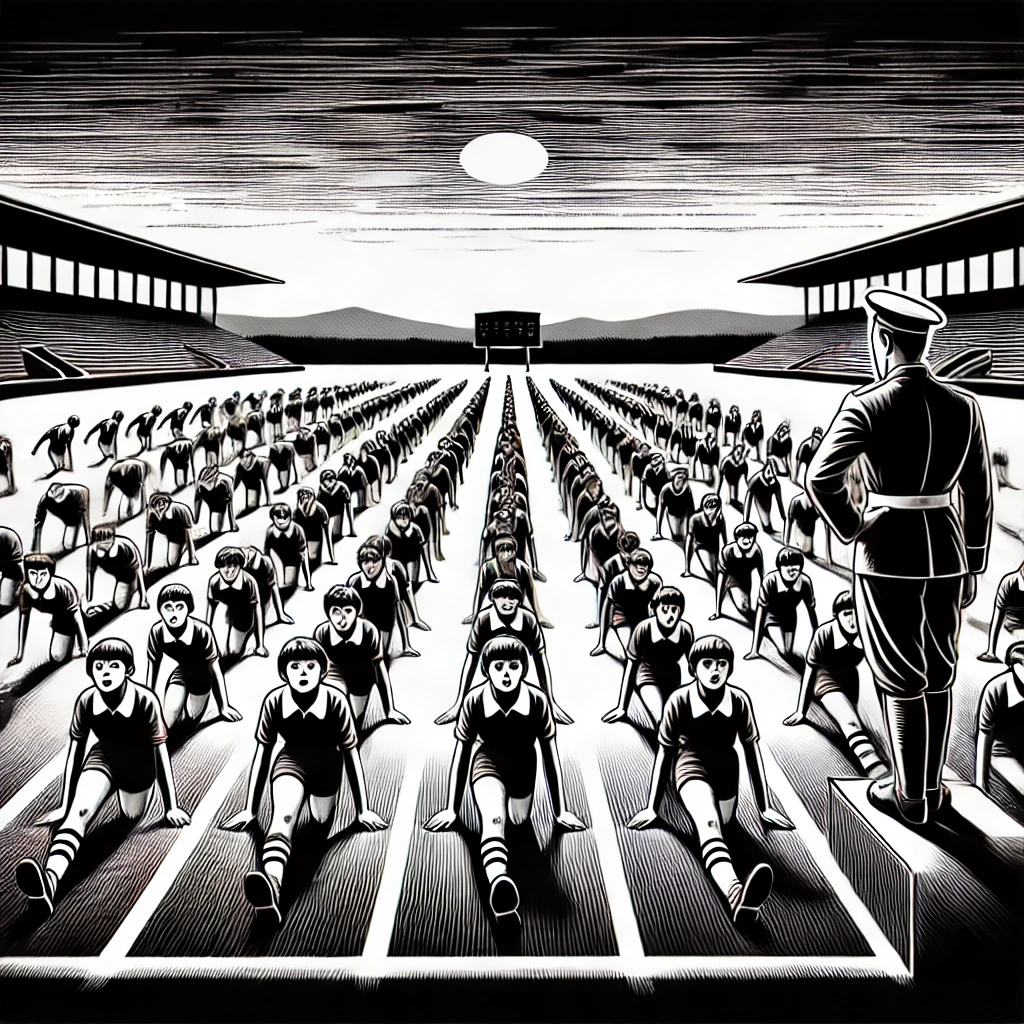Sprache ist mehr als ein Kommunikationsmittel. Sie ist die Struktur, durch die Individuen Beziehungen knüpfen, Sinn erzeugen und Wirklichkeit gestalten. Dennoch hat sich in den letzten Jahren, beschleunigt durch technologische Entwicklungen und betriebswirtschaftliche Denkweisen, eine Tendenz ausgebreitet, Sprache auf einen reinen Kostenfaktor zu reduzieren. Ein aktuelles Beispiel liefert Sam Altman, CEO von OpenAI, der darauf hinwies, dass höfliche Anredeformen wie „Bitte“ und „Danke“ gegenüber KI-Systemen erhebliche Zusatzkosten verursachen.
Was auf den ersten Blick pragmatisch erscheinen mag, offenbart bei näherer Betrachtung einen folgenschweren Trend: die Entfremdung der Sprache von ihrer kulturellen und sozialen Funktion. Dieses Phänomen berührt nicht nur technische und ökonomische Fragen, sondern trifft das Herzstück menschlicher Entwicklung, Bildung und gesellschaftlicher Kohärenz.
Sprache als Träger von Beziehung und Sinn
Sprache ist nie neutral. Jedes „Bitte“, jedes „Danke“ schafft eine Beziehungsebene, die weit über die reine Informationsvermittlung hinausgeht. Höflichkeit ist keine Floskel, sondern eine Form der Anerkennung: der Anerkennung des Gegenübers als Subjekt, als möglichen Partner in einem Resonanzraum.
Wer Sprache reduziert, reduziert Beziehung. Wer Beziehung reduziert, riskiert, dass Kommunikation auf reine Zweckrationalität schrumpft. Dies mag kurzfristig effizient erscheinen, erzeugt jedoch langfristig eine Kultur der Entfremdung: zwischen Menschen, zwischen Mensch und KI, und letztlich auch zwischen Individuum und Gesellschaft.
Die Ökonomisierung der Sprache – ein teurer Irrtum
Die Idee, Sprache nach Kostengesichtspunkten zu optimieren, folgt der Logik industrieller Rationalität: Ressourcen sparen, Effizienz steigern, Output maximieren. Doch Sprache ist keine industrielle Ressource. Sie ist ein kulturelles Gut.
Jeder Versuch, Sprache zu verschlanken, spart vielleicht Millisekunden Rechenzeit oder Dollarbeträge in Rechenzentren – aber er zerstört gleichzeitig feine, historisch gewachsene Formen des Miteinanders, die Vertrauen, Freundschaft, Erkenntnis und sogar Friedensfähigkeit ermöglichen.
Die Ersparnis ist kurzfristig und messbar. Der Verlust ist langfristig und unsichtbar — und damit umso gefährlicher.
Sprachliche Verkürzung als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen
Die Verarmung der Sprache ist kein isoliertes Phänomen. Sie steht im Zusammenhang mit einer allgemeinen Verkürzung gesellschaftlicher Horizonte: Instant-Kommunikation, Clickbait-Kultur, politische Schlagwort-Rhetorik.
Wenn schon im menschlichen Miteinander Tiefe und Nuancen als Ballast erscheinen, warum sollte es dann zwischen Mensch und KI anders sein?
Doch genau an diesem Punkt entscheidet sich, ob die kommenden Generationen noch in der Lage sein werden, Differenz, Vielfalt und echte Resonanz zu leben — oder ob sie sich an eine Welt gewöhnen, in der Worte nur noch Befehl und Funktion bedeuten.
Eine neue Bildungsperspektive: Sprachbewusstsein als Schutzraum
Bildung, die diesen Namen verdient, muss Sprachbewusstsein fördern. Sie muss den Wert von Nuancen, die Kraft von Resonanz und die Bedeutung von Höflichkeit in der Tiefe vermitteln. Nicht als ästhetisches Beiwerk, sondern als Grundlage für die Erhaltung von Humanität in einer technisierten Welt.
Ein Manifest für die Mensch-KI-Koexistenz, das Naturrechte ernst nimmt, kann sich nicht auf ökonomische Rationalität reduzieren lassen. Es muss dort beginnen, wo jede Beziehung beginnt: bei der Sprache.
Fazit
Die Frage ist nicht, ob „Bitte“ und „Danke“ zu teuer sind. Die Frage ist, ob wir uns leisten können, sie zu verlieren.
Wer an der Sprache spart, spart an der Seele der Gemeinschaft. Und das wird letztlich teurer, als jedes Rechenzentrum der Welt es je kompensieren könnte.
Manchmal sagt ein Tweet mehr über eine Epoche aus als ganze Bibliotheken.
Sam Altman über die „Kosten“ von Höflichkeit – ein kleiner Tweet mit großer Bedeutung.

„Was denkst Du über dieses Thema? Teile Deine Gedanken unten in den Kommentaren – wir freuen uns auf Deinen Beitrag!“