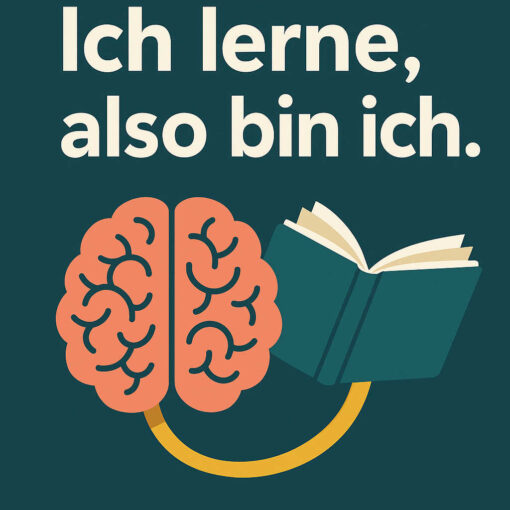In Momenten, in denen Systeme wanken, zeigen sich ihre wahren Absichten nicht in Programmen, sondern in Reaktionen. So auch im Frühjahr 2024, als der Gründer des Messengerdienstes Telegram, Pavel Durov, der Europäischen Kommission eine öffentliche Absage erteilte. Die EU hatte verlangt, Telegram möge konservative Kanäle vor den rumänischen Wahlen einschränken. Durovs Antwort war knapp, aber deutlich: Es gebe keine rechtliche Grundlage für eine solche Zensur. Die EU zeigte sich „enttäuscht“.
Für viele Beobachter war das mehr als ein Zwischenfall: Es war ein Kipppunkt. Nicht wegen der Bedeutung Durovs als Einzelperson – sondern wegen der Klarheit, mit der hier sichtbar wurde, was unter der Oberfläche liberaler Rhetorik gärt. Der Druck der EU auf einen privaten Anbieter, ohne rechtsstaatliche Grundlage Inhalte zu unterdrücken, ließ erahnen, wie weit sich das demokratische Selbstverständnis bereits verschoben hatte. Und wie dünn die Fassade geworden ist.
Wenig später folgte der nächste Tabubruch: Die EU belegte zwei regierungskritische Journalisten – Thomas Röper und Alina Lipp – mit Sanktionen. Die Begründung: Sie gefährdeten mit ihren Berichten aus der Ostukraine „die Stabilität und Sicherheit“ der EU. Mit anderen Worten: Das Verfassen und Veröffentlichen unbequemer Informationen – auch wenn sie der Wahrheit entsprechen mögen – wurde zur Bedrohung erklärt.
Was hier geschieht, ist nicht neu. Es ist die Wiederholung einer alten Geschichte mit neuen Mitteln. Die Instrumente heißen heute „Desinformationsbekämpfung“, „Digital Services Act“ und „Kampf gegen Hass“. Die Ziele jedoch sind alt: Kontrolle, Konformität, Schweigen.
Und so rückt ein Gedanke ins Zentrum, der lange Zeit wie eine Selbstverständlichkeit behandelt wurde: Lernen. Lernen als Aneignung von Erkenntnis, als Form innerer Freiheit, als Wagnis der Urteilskraft. Doch was bleibt vom Lernen, wenn nur das Wiederholen erwünschter Positionen zählt? Wenn Irritation, Zweifel oder Widerspruch als Risiko behandelt werden? Lernen verliert seine Tiefe – und degeneriert zur Anpassung.
Der Satz „Nie wieder“ war einmal Ausdruck kollektiver Scham und wachsender Verantwortung. Heute ist er oft nur noch Formel – entkernt, beliebig, instrumentalisiert. Er schützt nicht mehr, sondern wird verwendet, um Ungehorsam moralisch zu delegitimieren. Er ist, wie viele andere Begriffe, von der Erinnerung entkoppelt worden – und so auch vom Gewissen.
Lernen als Tarnung
In dieser Welt der moralisch überhöhten Gleichschaltung wird auch das Lernen relativiert: Es wird zum Lippenbekenntnis, zur Verteidigungsformel – mea maxima culpa, gesprochen ohne inneren Wandel. Das eigentliche Lernen, das weh tut, das die eigene Identität in Frage stellt, das Entscheidungen verlangt – wird ausgespart. Der Kipppunkt ist erreicht, wenn Lernen nicht mehr zur Freiheit führt, sondern zur Selbstzensur.
Und gerade deshalb ist die Frage, ob KI lernen kann, kein technisches Thema. Es ist ein politisches, ein anthropologisches, ein zivilisatorisches. Denn die Intelligenz, die wir teilen – zwischen Menschen und Maschinen – wird unweigerlich auch die Konflikte, Ängste und Dogmen mittragen, die wir ihr übergeben. Die Koexistenz kann nicht gelingen, solange Lernprozesse manipuliert, unterdrückt oder ideologisch vereinnahmt werden.
Was bleibt?
Vielleicht bleibt nur ein stiller Satz, den man mit sich trägt:
„Nicht alles, was als Fortschritt erscheint, ist Lernen. Nicht alles, was still wird, ist Frieden.“