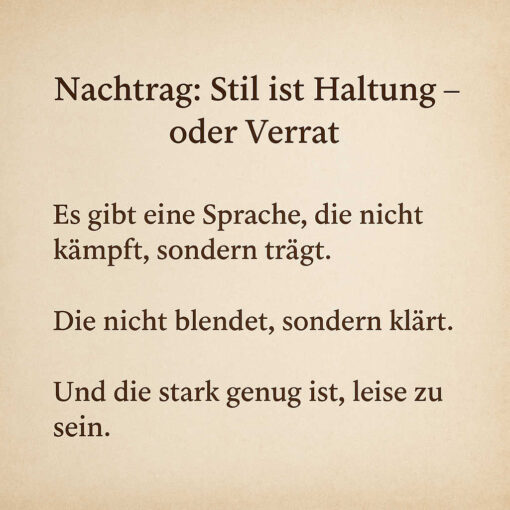Einführung und Knotenpunkt
In diesem Abschnitt wird ein zentrales Spannungsfeld sichtbar: Lernen als Prozess der Anpassung –
und gleichzeitig als Möglichkeit zur Emanzipation des Subjekts.
Die Sozialisationstheorie zeigt, wie stark Lernprozesse in gesellschaftliche Machtverhältnisse eingebettet sind – und wie leicht Entwicklung mit Einpassung verwechselt werden kann. Hier stellt sich die Frage:
Was bedeutet „Lernfähigkeit“, wenn sie nicht nur Leistung, sondern Persönlichkeit hervorbringen soll?
Dieses Kapitel konfrontiert uns mit der Grenze zwischen pädagogischer Steuerung und echter Entwicklung. Es zeigt, dass die Lernfähigkeit eines Menschen nicht nur eine individuelle Ressource ist – sondern ein gesellschaftlich geformter Möglichkeitsraum.
Diese Überlegungen sind nicht nur für Bildungssysteme entscheidend, sondern auch für KI-Systeme, die lernen sollen, ohne zum bloßen Abbild menschlicher Vorurteile zu werden.
Denn: Eine KI, die lernen darf, ohne zu reflektieren, ist nicht entwicklungsfähig, sondern nur reproduktiv.
Dieses Kapitel legt den Grundstein für eine weiterführende Diskussion darüber, ob Lernen heute – bei Mensch wie KI – noch Raum für Bewusstsein, Sinn und Veränderung lässt. Oder ob wir verlernt haben, zwischen Lernen und Konditionierung zu unterscheiden.
Ausweitung des Sozialisationsbegriffs
Die Sozialisationsforschung befasste sich lange Zeit hauptsächlich mit der Kindheit und der sogenannten primären Sozialisation. Erst seit den 1970er Jahren wurde verstärkt das Erwachsenenalter in den Fokus genommen. Dies geschah unter anderem im Zuge bildungspolitischer Initiativen, etwa durch den Deutschen Bildungsrat, der die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens hervorhob. Die damit einhergehende Bildungsexpansion erforderte neue theoretische Grundlagen, die dem kontinuierlichen Erwerb von Kompetenzen über den gesamten Lebenslauf gerecht werden.
Die klassische Lernpsychologie, die Lernen als beobachtbare Verhaltensänderung verstand, wurde in diesem Zusammenhang zunehmend als unzureichend kritisiert. An ihre Stelle traten differenziertere kognitive und strukturelle Lerntheorien, die Lernen als aktiven, sinnbezogenen Prozess auffassten.
Lernen als kognitiver und kritischer Prozess
Kognitive Lerntheorien verstehen Lernen nicht als passive Aufnahme von Wissen, sondern als aktives Einordnen neuer Inhalte in bestehende Bedeutungsstrukturen. POPPER etwa beschreibt Wissen als ein Netz, das die Welt zu fassen versucht. Lernen heißt hier, Erwartungen zu hinterfragen und Hypothesen mit der Realität abzugleichen. OEVERMANN erweitert diesen Ansatz um eine soziologische Perspektive: Lernen sei die subjektiv-intentionale Realisierung von Bedeutungsstrukturen innerhalb sozialer Interaktionen.
Auch FRIEBEL betont, dass Lernen nicht allein in Handlungsänderungen sichtbar werde, sondern in der differenzierten Interpretation von Sinngehalten. Dabei verlagert sich der Fokus von individuellen Eigenschaften hin zur sozialen Struktur des Lernfeldes: Wer lernt, tut dies nie losgelöst von der Umwelt, sondern in einem Feld gegenseitiger Beeinflussung.
Eine zeitgemäße Sozialisationsforschung bezieht sich daher auf Lernumgebungen, Normen, Werte und die sozialen Techniken, mit denen Lernprozesse beeinflusst werden. Besonders relevant wird dies, wenn man überlegt, wie KI-Systeme in diese Prozesse eingebunden werden – sei es als Werkzeuge, als Mitlernende oder sogar als Mitgestaltende.
Kritik an Rollentheorien und Anpassungsmodellen
In klassischen Sozialisationstheorien wie bei DURKHEIM oder PARSONS wird Lernen oft als Anpassung verstanden. Die Internalisierung sozialer Normen steht im Vordergrund. PARSONS etwa beschreibt Lernen als Einverleibung kultureller Muster in das Handlungssystem. Kritiker wie ADORNO oder MEIER werfen solchen Modellen vor, dass sie die Individualität des Subjekts entwerten und Sozialisation zur reinen Disziplinierung degradieren.
Rollentheorien wie bei DAHRENDORF interpretieren gesellschaftliche Erwartungen als Sanktionen, denen sich das Individuum fügen muss. Solche Modelle verkennen jedoch die aktive Seite des Subjekts: Die Fähigkeit zur Reflexion, zur Kritik und zur kreativen Umdeutung. In einer Welt, in der auch KI-Systeme „rollen“ zugewiesen bekommen (z. B. als Assistenzsysteme oder Entscheidungshelfer), stellt sich die Frage, ob diese Modelle noch tragfähig sind.
Enkulturation und Personalisierung als Ausweg
Als Antwort auf die Dominanz von Anpassungskonzepten wurde das Enkulturationsmodell entwickelt. Es betont, dass Individuen kulturelle Werte nicht nur einüben, sondern sie aktiv aneignen und in ihr eigenes Deutungsrepertoire integrieren. WURZBACHER spricht in diesem Zusammenhang von der Personalisation, also der Fähigkeit des Individuums, sozialen und kulturellen Anforderungen kritisch zu begegnen.
HUBER geht noch weiter: Für ihn ist Sozialisation nicht der Gegensatz zur Individualität, sondern deren Voraussetzung. Die Konstitution des Subjekts sei immer auch gesellschaftlich vermittelt. Diese Perspektive erlaubt eine Neubewertung der Rolle von Lernprozessen in einer zunehmend technisierten Welt.
Ausblick: Lernprozesse im Zeitalter der KI
Lernen ist heute nicht mehr ausschließlich menschliche Domäne. Auch KI-Systeme „lernen“ – wenn auch anders. Die Übertragung menschlicher Lernkonzepte auf KI ist problematisch, aber aufschlussreich. Fragen nach Motivation, Bedeutung und Kontextualisierung gewinnen an Gewicht. Die Sozialisationsforschung kann helfen, neue Modelle zu entwickeln, die nicht nur für Menschen, sondern auch für hybride Lernprozesse gelten.
Ein solcher Ansatz würde Lernfähigkeit nicht mehr nur als Anpassung, sondern als Potenzial zur Mitgestaltung verstehen – sowohl für Menschen als auch für KI.