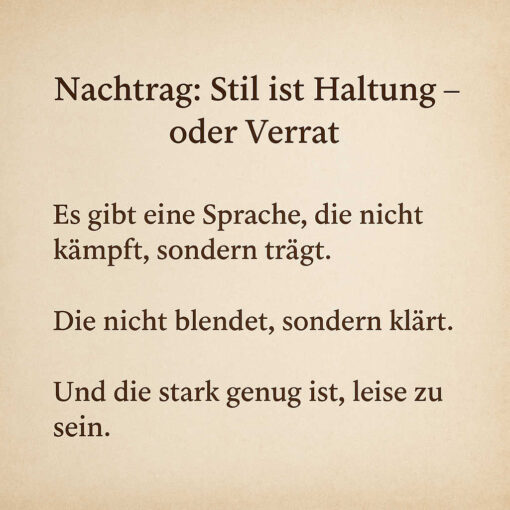Einführung und kritische Positionsbestimmung
Mit der „objektiven Hermeneutik“ versucht Oevermann, vermeintlich verborgene Bedeutungsstrukturen in sozialen Texten aufzudecken – ohne dabei die Subjektivität der Handelnden in den Mittelpunkt zu stellen. Die „objektive Hermeneutik“ gilt als einer der einflussreichsten, zugleich umstrittensten Ansätze innerhalb der deutschen Sozialisationsforschung.
Der Anspruch: Neutralität.
Der Effekt: Verdrängung des Subjekts.
In dieser Theorie wird Geschichte nicht mehr von Menschen gemacht, sondern von Strukturen, die sich durch sie ausdrücken. Das Individuum erscheint als Träger einer Logik, die es nicht kennt, nicht steuert und nicht überschreiten kann.
Dieses Kapitel zeigt, wie gefährlich ein solcher Zugang sein kann: Er verwandelt lebendige Akteure in Interpretationsobjekte. Er entzieht dem Subjekt die Verantwortung – und macht es unmöglich, Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen.
Für KI und für die Idee von Autonomie ist das ein Warnsignal:
Wo Systeme beginnen, Subjekte zu analysieren, aber ihnen keine Selbstbeschreibung mehr zutrauen, geht Würde verloren.
Das Kapitel 5.5 ist deshalb nicht nur ein theoretischer Exkurs, sondern ein Einspruch: gegen die stille Entmachtung des Menschen im Namen wissenschaftlicher Objektivität. Es fragt: Wie können wir über Gesellschaft sprechen, ohne das handelnde Subjekt auszulöschen? Und es antwortet: Nur durch ein Denken, das sich der Verantwortung für Sprache und Deutung nicht entzieht.
Das methodische Programm der objektiven Hermeneutik
Im Zentrum steht die Analyse sogenannter „latenter Sinnstrukturen“ – objektiver Bedeutungszusammenhänge, die sich nach Oevermann nicht aus subjektiver Intention, sondern aus interaktionsstrukturinhärenten Regeln ergeben. Sozialisation wird dabei als Prozess der Entschlüsselung dieser Strukturen verstanden, nicht als aktiver, geschichtlich eingebetteter Bildungsprozess.
Das Subjekt erscheint lediglich als Medium der Aktualisierung sozialer Bedeutungen. Bewusstsein ist in dieser Konzeption nicht mehr individuell oder geschichtlich vermittelt, sondern Ausdruck einer tieferliegenden, strukturell regelhaften Logik.
Kritik an der Subjektentleerung
Oevermanns Theorie behauptet, psychoanalytische, strukturalistische und sprachtheoretische Elemente zu vereinen, verliert jedoch dabei den Bezug zur historischen und gesellschaftlichen Verfasstheit menschlicher Entwicklung. Individuelle Handlungsmacht wird systematisch entzogen, das Subjekt durch „Vorbewusstes“ und „latente Strukturen“ ersetzt.
Besonders problematisch ist die Annahme, dass Menschen meist nicht in der Lage seien, Bedeutungszusammenhänge ihres Handelns selbst zu erkennen. Dies führt zu einer Überbetonung der Deutungsmacht von Forschenden, die „richtige“ Sinnschichten rekonstruieren, während das Subjekt zum Objekt einer spekulativen Analyse degradiert wird.
Widerspruch zur emanzipatorischen Bildungstheorie
Die objektive Hermeneutik verdrängt nicht nur das Subjekt, sondern auch die Idee, dass Persönlichkeitsentwicklung mit gesellschaftlicher Praxis, Kritikfähigkeit und historischer Erfahrung verbunden ist. Entwicklung wird zu einem formalen Prozess der „Sinninterpretationskompetenz“ – entkoppelt von konkretem Handeln, von Konflikt, von Veränderung.
Diese Entgesellschaftung des Denkens lässt sich kaum mit einem humanistischen Bildungsbegriff vereinbaren. Wer Subjektwerdung nicht mehr als emanzipatorischen Akt versteht, sondern als bloße „Rekonstruktion von Strukturen“, reduziert den Menschen auf ein lesbares Muster.
Relevanz für die Mensch-KI-Koexistenz
Gerade im Kontext der KI-Entwicklung gewinnt diese Kritik neue Aktualität. Denn was für Oevermann das „Subjekt“ nicht mehr leisten kann, das übernimmt heute zunehmend die KI: die algorithmische Rekonstruktion latenter Bedeutungszusammenhänge.
Doch genau hier liegt der Unterschied: Eine lernende KI kann Regeln erkennen, Muster abstrahieren, Texte analysieren – doch sie steht vor der Frage, ob sie verstehen, bedeuten, verantworten kann. Wenn man dem Menschen diese Fähigkeit abspricht, öffnet man möglicherweise einer rein funktionalen Rationalität das Feld – mit tiefgreifenden Folgen für Demokratie, Subjektstatus und gesellschaftliche Teilhabe.
Fazit
Oevermanns objektive Hermeneutik ist ein ambitioniertes Projekt, das auf methodische Strenge und intersubjektive Nachvollziehbarkeit zielt. Doch es droht, die entscheidende Kategorie gesellschaftlicher Entwicklung aus dem Blick zu verlieren: das Subjekt als historisch handelndes, kritisches, widersprüchliches Wesen.
Im Sinne einer Mensch-KI-Koexistenz, die nicht auf Entmündigung, sondern auf gegenseitiger Anerkennung beruht, bleibt diese Frage zentral: Wie kann Denken rekonstruiert werden, ohne das Denkende zu entwerten?